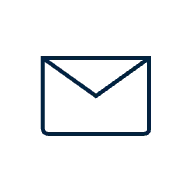Wohnrecht: Das sollten Sie vor der Vereinbarung beachten
Das Wohnrecht berechtigt Menschen, eine Immobilie zu bewohnen ohne selbst Eigentümer zu sein.
Erfahren Sie hier u.a., in welchen Fällen sich das lebenslange Wohnrecht anbietet und wie es vereinbart wird.
Das Wichtigste zusammengefasst:
Wohnrecht ist die vertragliche Befugnis, eine Immobilie oder Teile davon zu bewohnen, ohne Eigentümer zu sein.
Lebenslanges Wohnrecht ermöglicht die Nutzung der Immobilie bis zum Tod des Berechtigten und kann nur mit dessen Zustimmung gelöscht werden.
Das Wohnrecht basiert auf Paragraph 1093 BGB und wird im Grundbuch eingetragen. Es wird oft in Verbindung mit Schenkungen verwendet, um z.B. Eltern das Wohnen in der Immobilie zu ermöglichen, während sie sie auf ihre Kinder übertragen.
Inhaltsverzeichnis
Wer übernimmt Nebenkosten und Instandhaltung beim Wohnrecht?
Bleibt das Wohnrecht auch bei einer Zwangsversteigerung bestehen?
Was ist der Unterschied zwischen Wohnungsrecht und Wohnrecht?
Lässt sich ein Wohnrecht auch bei einem Mietverhältnis eintragen?
Ihre Immobilie – Ihr Kapital:
Finden Sie heraus, wie viel Ihre Immobilie wert ist, bevor Sie sie verschenken und sich um Wohnrecht kümmern müssen.
Was steckt hinter dem Begriff Wohnrecht?
Grundsätzlich handelt es sich beim Wohnrecht um die vertraglich festgesetzte Befugnis, eine Immobilie oder Teile von ihr zu bewohnen, ohne selbst Eigentümer zu sein.
Was bedeutet lebenslanges Wohnrecht?
Wird ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt, darf der Berechtigte die Immobilie bis zu seinem Lebensende nutzen. Das Recht kann nur gelöscht werden, wenn der Berechtigte sich einverstanden erklärt. Ohne die Zustimmung zur Löschung erlischt das Wohnrecht erst mit dem Tod des Wohnberechtigten.
Auf welcher rechtlichen Grundlage gründet sich das Wohnrecht?
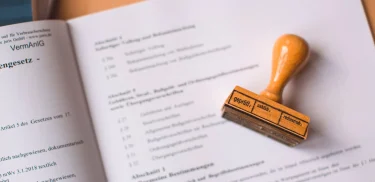
Das in der Praxis am häufigsten gewählte Wohnrecht gründet sich auf Paragraph 1093 BGB, welcher das Wohnrecht als beschränkte persönliche Dienstbarkeit definiert. Demnach berechtigt das Wohnrecht „[…]ein Gebäude oder einen Teil eines Gebäudes unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu benutzen.“ Das gilt sowohl für den Wohnberechtigten selbst als auch für seine Familienmitglieder sowie etwaige Bedienstete und Pflegekräfte. Das Wohnrecht wird im Grundbuch eingetragen.
In welchen Fällen bietet sich Wohnrecht an?
In der Praxis kommt die Eintragung eines Wohnrechts häufig in Verbindung mit einer Schenkung vor. So sichern sich Eltern beispielsweise ein lebenslanges Wohnrecht für ihre Immobilie, wenn sie diese zu Lebzeiten auf ihre Kinder überschreiben, aber dennoch weiter bewohnen möchten. Die Schenkung bietet sich dabei aus finanziellen (Freibetrag, Erbschaftssteuer) oder persönlichen (Erbengemeinschaft, Erbauseinandersetzung, gesetzliche Erbfolge) Gründen als Alternative zum Vererben eines Hauses an.
„Wenn der Immobilienbesitzer den aktuellen Lebenspartner im Todesfall absichern möchte eignet sich das Wohnrecht auf Lebenszeit. So kann er den Partner gegen erbrechtliche Ansprüche Dritter schützen.“
Wie wird das Wohnrecht vertraglich vereinbart?
Es empfiehlt sich, das Wohnrecht in einem notariell beglaubigten Vertrag festzuhalten, der alle Rechte und Pflichten des Eigentümers und Wohnberechtigten beinhaltet. Anschließend sollte der Notar die Eintragung des Wohnrechts im Grundbuch veranlassen. Denn nur so ist gewährleistet, dass das Wohnrecht auch im Streitfall von Eigentümer und Wohnberechtigtem oder beim Immobilienverkauf weiter besteht.
Je nach Vereinbarung lässt sich das Wohnrecht befristet oder auf Lebenszeit, unentgeltlich oder gegen Abgabe eines monatlichen Beitrags einräumen. In der Praxis vereinbaren die Parteien oft ein lebenslanges Wohnrecht ohne Gegenleistung.
Bevor Sie Ihre Immobilie übertragen
und ein Wohnrecht vereinbaren, entdecken Sie den Marktwert, den Sie weitergeben. Hier können Sie den Immobilienwert direkt online berechnen!
Wie wird das Wohnrecht in das Grundbuch eingetragen?
Grundsätzlich können die Parteien das Wohnrecht vertraglich vereinbaren, ohne dass eine Grundbucheintragung erfolgt. In diesem Fall besteht die Vereinbarung zwar zwischen dem Immobilieneigentümer und dem Wohnberechtigten, nicht aber gegenüber Dritten, etwa wenn die Immobilie verkauft wird. Es ist also sinnvoll, das Wohnrecht im Grundbuch eintragen zu lassen.
Üblicherweise veranlasst der Notardie Eintragung des Rechts. Das Wohnrecht wird als beschränkt persönliche Dienstbarkeit in Abteilung II des Grundbuchs unter Lasten und Beschränkungen vermerkt.
Welche Rechte und Pflichten gehen mit dem Wohnrecht einher?
Um das Zusammenleben von Eigentümer und Wohnberechtigtem zu regeln, definieren die Gesetze, wer in diesem Verhältnis welche Zuständigkeiten innehat.
Folgende Rechte und Pflichten spricht das Gesetz dem Berechtigten nach Paragraph 1093 BGB zu:
Nutzungsrecht: Ist das Wohnrecht nur auf einen Teil der Immobilie beschränkt, also zum Beispiel bei einem Mehrfamilienhaus auf nur eine Wohnung, darf der Berechtigte gemeinschaftliche Anlagen und Einrichtungen des Hauses (Waschküche, Garten oder Keller) ebenfalls mit nutzen.
Aufnahmerecht: Der Wohnberechtigte darf Personen seiner Familie (seinen Ehepartner und Kinder oder einen nichtehelichen Lebenspartner) in die Immobilie aufnehmen. Selbiges gilt für Bedienstete und für Personen, die er für seine Pflege beschäftigt.
Besichtigungsrecht: Dem Eigentümer steht es nicht zu, die Wohnung zu begutachten.
Wer übernimmt Nebenkosten und Instandhaltung beim Wohnrecht?
Nebenkosten: Anfallende Betriebskosten sind vom Wohnberechtigten selbst zu tragen.
Reparaturkosten: Der Wohnberechtigte hat die Kosten von Erhaltung und Reparatur der Immobilie zu tragen. Der Eigentümer ist grundsätzlich für Sanierungsmaßnahmen zuständig. Jedoch hat der Wohnberechtigte hierauf keinen gesetzlichen Anspruch. Möchte der Besitzer einer Immobilie jedoch Maßnahmen wie eine Sanierung oder einen Umbau einleiten, benötigt er dafür zunächst die Zustimmung des Wohnberechtigten.

Ist ein Wohnrecht zu versteuern?
Ein Wohnrecht bedeutet in der Regel, in einer Immobilie zu wohnen, ohne dafür eine Miete zu zahlen. Damit stellt das Wohnrecht einen Geldwert beziehungsweise eine Vermögensübertragung dar, auf welche der Fiskus Steuern erhebt.
Rechnerisch ergibt sich der Wert des Wohnrechts aus der Jahreskaltmiete, multipliziert mit dem sogenannten Kapitalwert. Der Kapitalwert gibt dabei –vereinfacht gesprochen – die noch zu erwartende Lebens- und somit Wohndauer des Berechtigten an.
Ein Beispiel: Frau Maier ist 75 Jahre alt. Sie hat ihrer Tochter ihre Eigentumswohnung überschrieben und sich ein lebenslanges Wohnrecht in der Immobilie gesichert. Die Kaltmiete für die Wohnung beträgt im Jahr 6.000 Euro. Um den Wohnwert zu ermitteln, ist sie mit dem Kapitalwert aus der Tabelle des Bundesfinanzministeriums zu multiplizieren. Er liegt für eine Frau im Alter von 75 Jahren bei 9,303. Somit beläuft sich der Wert des Wohnrechts von Frau Maier auf 55.818 Euro.
Ist das Wohnrecht auf andere Personen übertragbar?
Es ist nicht möglich, das Wohnrecht zu vererben, zu verkaufen oder auf anderem Wege auf einen Dritten zu übertragen. Auf Wunsch des Berechtigten lässt sich das Wohnrecht jedoch aus dem Grundbuch löschen.
Ohne eine aktive Handlung des Wohnberechtigten endet das Recht nur in folgenden Fällen:
Der Wohnberechtigte verstirbt
Die Räumlichkeiten sind nicht mehr bewohnbar
Der befristete Vertrag läuft aus
Bei vertraglicher Nutzungsbedingung, wenn die Bedingung wegfällt
Für wen gilt das lebenslange Wohnungsrecht?
Das lebenslange Wohnrecht gilt für die berechtigte Person. Zudem darf der Berechtigte andere Personen wie etwa Familienangehörige, einen Lebensgefährten oder Haushaltshilfen und Pflegepersonal in die Immobilie aufnehmen.
Lässt sich eine Immobilie auch mit Wohnrecht verkaufen?
Es ist grundsätzlich möglich, ein Haus oder eine Wohnung auch mit einem vertraglich vereinbarten Wohnrecht zu verkaufen. Verkäufer müssen jedoch mit einem niedrigeren Verkaufspreis als beim Verkauf von einer freien Immobilie rechnen. Rechnerisch wird hier der Wert des Wohnrechts vom Immobilienwert abgezogen. Um die Immobilie zu einem guten Preis zu verkaufen, ist es möglich, dem Wohnberechtigten eine Abfindung anzubieten, damit dieser auf sein Wohnrecht verzichtet.
Gut zu wissen: Um eine Immobilie trotz Wohnrechts zu verkaufen, benötigen Sie keine Einwilligung des Wohnberechtigten. Er hat kein Vetorecht. Jedoch bleibt seine Position vom Verkauf unberührt.